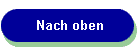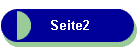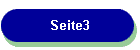home
aquaristik
exoten reisen
schule sitemap
volltextsuche gästebuch
kontakt
impressum
Sieben Monate später, am 15.10.1998 flogen wir von Berlin
Tegel nach Port Elizabeth. Vor uns lag eine Rundreise über fast 2000 Km entlang
der Küste bis nach Kapstadt. Natürlich waren die Erwartungen hochgesteckt und
selbstverständlich hatten wir neben den persönlichen Sachen auch unsere
Fangausrüstung dabei. Neben unserem aquaristischen Interesse sollten aber auch
allgemeinbiologische Sachverhalte, wie die Säugetier-, Avio- und Reptilienfauna
den Schwerpunkt unserer Exkursionen bilden. Und selbstverständlich waren wir
gespannt auf die Flora des Kaps, die in der Literatur als einmalig beschrieben
wird. Um es vorweg zu nehmen: Fische in der Kapregion zu fangen ist nahezu
aussichtslos. Einmal sind die Naturschutzbestimmungen in Südafrika sehr strikt
(sicherlich berechtigt) und zum anderen ist es ausgesprochen problematisch an
die interessanten Gewässer heranzukommen, weil sie fast ausnahmslos entweder in
Privatbesitz sind oder unter Naturschutz stehen.
nehmen: Fische in der Kapregion zu fangen ist nahezu
aussichtslos. Einmal sind die Naturschutzbestimmungen in Südafrika sehr strikt
(sicherlich berechtigt) und zum anderen ist es ausgesprochen problematisch an
die interessanten Gewässer heranzukommen, weil sie fast ausnahmslos entweder in
Privatbesitz sind oder unter Naturschutz stehen.
Daß wir trotzdem Fische mit nach Deutschland bringen
konnten, verdanken wir Dr. Jim Cambray, Kustos für Süßwasserfische am Albany
Museum Grahamstown, mit dem wir uns am ersten Abend unserer Reise in Port
Elizabeth trafen.
In Anlehnung an unsere Erfahrungen mit Anabas testudineus
berichtete er uns über sein Projekt zum Schutz von Sandelia bainsii.
Der „Eastern Cape Rocky", wie S. bainsii in
Südafrika genannt wird, gehört zur Familie der Anabantidae und mit bis zu 26
cm Länge zu den großen Arten in dieser Gruppe. Im Gegensatz zu anderen
Vertretern der Familie, bildet Sandelia kein Labyrinthorgan aus. Eine
weitere anatomische Besonderheit stellt die Schwimmblase dar, die langgestreckt
vom Ansatz der Schwanzflosse bis zum Kopf reicht. Außer S. bainsii gibt
es nur noch eine weitere Art in der Gattung, S. capensis. Letztere ist in
der westlichen Kapregion weit verbreitet. Das Verbreitungsgebiet von S.
bainsii ist hingegen sehr klein und umfaßt lediglich kleine Habitate im
Kowie, Great Fish, Keiskamma, Buffalo und Nahoon River. Durch die Verschleppung
von in Südafrika als Katzenwelse bezeichnete Clarias gariepinus ( nicht
zu verwechseln mit den aus Nordamerika bei uns eingebürgerten Ictalurus
nebulosus) in diese Flüsse wurden die ohnehin schon kleinen Bestände
erheblich dezimiert. Ein weitere Gefahr droht nun den Restbeständen durch die
Massenvermehrung des südamerikanischen Schwimmfarns Azolla filiculoides,
der sicherlich nicht zu Unrecht als Pest bezeichnet wird. Durch keinerlei
Freßfeinde dezimiert, aber durch anthropogene Eutrophierung unterstützt,
vermehrt sich diese Azolla so stark, daß mehrere Zentimeter starke
Schichten der Pflanze die Gewässer bedecken und damit den Gasaustausch
verhindern. Die auf Grund des Sauerstoffmangels zur Oberfläche strebenden
Fische können zwar die Farnschicht durchbrechen, aber nicht mehr in das Wasser
zurück, so daß insbesondere halbwüchsige Tiere schlicht vertrocknen. Dr. J.
Cambray, der ein Projekt zum Erhalt der Art initiiert hat, rechnet damit, daß
die schon heute auf der roten Liste stehende Art in den nächsten zwanzig Jahren
ausgestorben sein wird, wenn nicht erhebliche Anstrengungen zum Schutz der
Lebensräume des „Eastern Cape Rocky" unternommen werden. Interessenten
können sich über den Fortgang der Entwicklung auf den Internet-Seiten des
Albany Museums (http://www.ru.ac.za/albany-museum.ichthy.html) informieren, oder
direkt mit Dr. J. Cambray Kontakt aufnehmen (e-mail: amjc@giraffe.ru.ac.za).
Obwohl wir uns vor der Reise fest vorgenommen hatten, S.
bainsii mitzubringen und in unseren Aquarien zu vermehren, haben wir
angesichts dieser Informationen von unserem Vorhaben Abstand genommen. Etwas
enttäuscht waren wir trotzdem, hatten wir doch gehofft, wenn schon keine
Wildfänge, so doch wenigstens Nachzuchten erhalten zu können.
In Heft 143 der TI berichtete ich bereits über die Vorteile
des Internet. In Vorbereitung der Tour wurden sie Realität. Jim konnte in
Vorbereitung der Tour bereits beim „Department of Economic Affairs" nicht
nur eine Fang- sondern auch Ausfuhrgenehmigung beantragen. Ohne die
entsprechende Unterstützung des Museums und das persönliche Engagement Jims
wäre das in der kurzen Zeit unseres Aufenthalts schier unmöglich gewesen.
Die Tiere, die jetzt in unseren Aquarien schwimmen,
entstammen dem Baakens River in der Nähe von Grahamstown. Leider erhielten wir
lediglich eine Fang- und Ausfuhrerlaubnis für Pseudocrenilabrus philander
(Weber, 1897). Das verwunderte uns ein wenig, denn nach P. Skeleton (1993), „Freshwater
Fishes of Southern Africa" dürfte es diese Art am östlichen Kap gar nicht
geben. Dennoch haben wir Fische mitgebracht, die eindeutig der Gattung
zuzuordnen sind. Auch neuere Literaturquellen geben die Verbreitungsgebiete der
Art P. philander weiter nördlich an und zwar sämtlich jenseits der
Zuur-Berge, aber niemals in Küstennähe. Angesichts der Tatsache, daß die
Berge bis zu 1100 m Höhe erreichen und damit eine Wasserscheide darstellen,
bleibt die Frage offen, wie die von uns mitgebrachten Tiere dieses Hindernis
überwinden konnten. Auch verschiedene systematische Fragen hinsichtlich der P.
philander – Gruppe sind derzeit noch ungeklärt. Zwar ist bei den von uns
mitgebrachten Tieren bereits eine Geschlechterdifferenzierung zu erkennen, aber
eine eindeutige Bestimmung der Art wird sich erst nach der erfolgreichen
Nachzucht vornehmen lassen. Die Unterschiede zu P. multicolor sind
allerdings so offensichtlich, daß wir mit großer Wahrscheinlichkeit
ausschließen können, daß die Tier zu dieser Art gehören. Besonders
auffallend sind die Abweichungen im Körperumriß (P. multicolor – keulenförmig,
P. philander – spindelförmig) und in der Zeichnung im weichstrahligen
Bereich der männlichen Afterflosse (P. multicolor – streifenförmig
und orange - P. philander – punktförmig und orange). Die
Körperzeichnung hingegen ist bei beiden „Arten" weitgehend identisch.
Obwohl P. philander als ausgewachsenes Exemplar mit einer Größe bis zu
13 cm angegeben wird, lassen sich bei den von uns mitgebrachten Exemplaren schon
bei einer Größe von 4 cm die Geschlechter unterscheiden. Die Männchen haben
über den ganzen Körper verteilt auf gelbem Untergrund blau-metallisch
glänzende Schuppen, die bei den Weibchen fehlen. Weitere Hinweise auf die
Artzugehörigkeit erhoffen wir durch die weitere Entwicklung der Tiere und das
Fortpflanzungsverhalten zu erhalten. Dann ist es vielleicht auch möglich anhand
der von uns mitgebrachten Tiere näher auf einige taxonomische Unklarheiten
einzugehen, die bereits von L. Seegers (1992) dargestellt wurden.
nördlich an und zwar sämtlich jenseits der
Zuur-Berge, aber niemals in Küstennähe. Angesichts der Tatsache, daß die
Berge bis zu 1100 m Höhe erreichen und damit eine Wasserscheide darstellen,
bleibt die Frage offen, wie die von uns mitgebrachten Tiere dieses Hindernis
überwinden konnten. Auch verschiedene systematische Fragen hinsichtlich der P.
philander – Gruppe sind derzeit noch ungeklärt. Zwar ist bei den von uns
mitgebrachten Tieren bereits eine Geschlechterdifferenzierung zu erkennen, aber
eine eindeutige Bestimmung der Art wird sich erst nach der erfolgreichen
Nachzucht vornehmen lassen. Die Unterschiede zu P. multicolor sind
allerdings so offensichtlich, daß wir mit großer Wahrscheinlichkeit
ausschließen können, daß die Tier zu dieser Art gehören. Besonders
auffallend sind die Abweichungen im Körperumriß (P. multicolor – keulenförmig,
P. philander – spindelförmig) und in der Zeichnung im weichstrahligen
Bereich der männlichen Afterflosse (P. multicolor – streifenförmig
und orange - P. philander – punktförmig und orange). Die
Körperzeichnung hingegen ist bei beiden „Arten" weitgehend identisch.
Obwohl P. philander als ausgewachsenes Exemplar mit einer Größe bis zu
13 cm angegeben wird, lassen sich bei den von uns mitgebrachten Exemplaren schon
bei einer Größe von 4 cm die Geschlechter unterscheiden. Die Männchen haben
über den ganzen Körper verteilt auf gelbem Untergrund blau-metallisch
glänzende Schuppen, die bei den Weibchen fehlen. Weitere Hinweise auf die
Artzugehörigkeit erhoffen wir durch die weitere Entwicklung der Tiere und das
Fortpflanzungsverhalten zu erhalten. Dann ist es vielleicht auch möglich anhand
der von uns mitgebrachten Tiere näher auf einige taxonomische Unklarheiten
einzugehen, die bereits von L. Seegers (1992) dargestellt wurden.
Zuhause angekommen stellten wir fest, daß unter den
gefangenen Tieren neben den P. philander auch zwei Tiere den typischen
„Tilapien-Fleck" unterhalb der Dorsale zu zeigen begannen. An dieser
Stelle muß angemerkt werden, daß keiner der Fische, die wir mitbrachten,
größer als 10 – 12 mm groß war. Via Internet nahmen wir nochmals Kontakt zu
Dr. Cambray auf, der uns mitteilte, daß es sich bei diesen Tieren
wahrscheinlich um Tilapia sparrmanii handelt. Nun hat aber auch diese Art
ihr Verbreitungsgebiet jenseits der Zuur-Berge, so daß hier ebenfalls die Frage
offen bleibt, wie die Tiere die natürliche Barriere überwinden konnten,
gesetzt den Fall, daß es sich tatsächlich um T. sparrmanii handelt.
Diese werden mit einer Größe von bis zu 23 cm angegeben. Dafür spricht die
Ausbildung eines kräftig roten Bandes, das sich über die gesamte Länge der
Dorsale zieht und das in dieser Form nur von T. sparrmanii ausgeprägt wird.
Gegenwärtig sind die Tiere auf circa 4 cm herangewachsen und mit ihrem fast
schwarzen Schachbrettmuster auf dem Körper und der hellen Punktzeichnung in der
Dorsalen sehr attraktiv. Es bleibt abzuwarten, ob beide Geschlechter vorhanden
sind. Bei lediglich zwei Exemplaren ist die Wahrscheinlichkeit wohl eher gering.
daß es sich tatsächlich um T. sparrmanii handelt.
Diese werden mit einer Größe von bis zu 23 cm angegeben. Dafür spricht die
Ausbildung eines kräftig roten Bandes, das sich über die gesamte Länge der
Dorsale zieht und das in dieser Form nur von T. sparrmanii ausgeprägt wird.
Gegenwärtig sind die Tiere auf circa 4 cm herangewachsen und mit ihrem fast
schwarzen Schachbrettmuster auf dem Körper und der hellen Punktzeichnung in der
Dorsalen sehr attraktiv. Es bleibt abzuwarten, ob beide Geschlechter vorhanden
sind. Bei lediglich zwei Exemplaren ist die Wahrscheinlichkeit wohl eher gering.
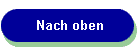
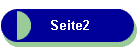
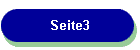
home
aquaristik
exoten reisen
schule sitemap
volltextsuche gästebuch
kontakt
impressum
 nehmen: Fische in der Kapregion zu fangen ist nahezu
aussichtslos. Einmal sind die Naturschutzbestimmungen in Südafrika sehr strikt
(sicherlich berechtigt) und zum anderen ist es ausgesprochen problematisch an
die interessanten Gewässer heranzukommen, weil sie fast ausnahmslos entweder in
Privatbesitz sind oder unter Naturschutz stehen.
nehmen: Fische in der Kapregion zu fangen ist nahezu
aussichtslos. Einmal sind die Naturschutzbestimmungen in Südafrika sehr strikt
(sicherlich berechtigt) und zum anderen ist es ausgesprochen problematisch an
die interessanten Gewässer heranzukommen, weil sie fast ausnahmslos entweder in
Privatbesitz sind oder unter Naturschutz stehen. nördlich an und zwar sämtlich jenseits der
Zuur-Berge, aber niemals in Küstennähe. Angesichts der Tatsache, daß die
Berge bis zu 1100 m Höhe erreichen und damit eine Wasserscheide darstellen,
bleibt die Frage offen, wie die von uns mitgebrachten Tiere dieses Hindernis
überwinden konnten. Auch verschiedene systematische Fragen hinsichtlich der P.
philander – Gruppe sind derzeit noch ungeklärt. Zwar ist bei den von uns
mitgebrachten Tieren bereits eine Geschlechterdifferenzierung zu erkennen, aber
eine eindeutige Bestimmung der Art wird sich erst nach der erfolgreichen
Nachzucht vornehmen lassen. Die Unterschiede zu P. multicolor sind
allerdings so offensichtlich, daß wir mit großer Wahrscheinlichkeit
ausschließen können, daß die Tier zu dieser Art gehören. Besonders
auffallend sind die Abweichungen im Körperumriß (P. multicolor – keulenförmig,
P. philander – spindelförmig) und in der Zeichnung im weichstrahligen
Bereich der männlichen Afterflosse (P. multicolor – streifenförmig
und orange - P. philander – punktförmig und orange). Die
Körperzeichnung hingegen ist bei beiden „Arten" weitgehend identisch.
Obwohl P. philander als ausgewachsenes Exemplar mit einer Größe bis zu
13 cm angegeben wird, lassen sich bei den von uns mitgebrachten Exemplaren schon
bei einer Größe von 4 cm die Geschlechter unterscheiden. Die Männchen haben
über den ganzen Körper verteilt auf gelbem Untergrund blau-metallisch
glänzende Schuppen, die bei den Weibchen fehlen. Weitere Hinweise auf die
Artzugehörigkeit erhoffen wir durch die weitere Entwicklung der Tiere und das
Fortpflanzungsverhalten zu erhalten. Dann ist es vielleicht auch möglich anhand
der von uns mitgebrachten Tiere näher auf einige taxonomische Unklarheiten
einzugehen, die bereits von L. Seegers (1992) dargestellt wurden.
nördlich an und zwar sämtlich jenseits der
Zuur-Berge, aber niemals in Küstennähe. Angesichts der Tatsache, daß die
Berge bis zu 1100 m Höhe erreichen und damit eine Wasserscheide darstellen,
bleibt die Frage offen, wie die von uns mitgebrachten Tiere dieses Hindernis
überwinden konnten. Auch verschiedene systematische Fragen hinsichtlich der P.
philander – Gruppe sind derzeit noch ungeklärt. Zwar ist bei den von uns
mitgebrachten Tieren bereits eine Geschlechterdifferenzierung zu erkennen, aber
eine eindeutige Bestimmung der Art wird sich erst nach der erfolgreichen
Nachzucht vornehmen lassen. Die Unterschiede zu P. multicolor sind
allerdings so offensichtlich, daß wir mit großer Wahrscheinlichkeit
ausschließen können, daß die Tier zu dieser Art gehören. Besonders
auffallend sind die Abweichungen im Körperumriß (P. multicolor – keulenförmig,
P. philander – spindelförmig) und in der Zeichnung im weichstrahligen
Bereich der männlichen Afterflosse (P. multicolor – streifenförmig
und orange - P. philander – punktförmig und orange). Die
Körperzeichnung hingegen ist bei beiden „Arten" weitgehend identisch.
Obwohl P. philander als ausgewachsenes Exemplar mit einer Größe bis zu
13 cm angegeben wird, lassen sich bei den von uns mitgebrachten Exemplaren schon
bei einer Größe von 4 cm die Geschlechter unterscheiden. Die Männchen haben
über den ganzen Körper verteilt auf gelbem Untergrund blau-metallisch
glänzende Schuppen, die bei den Weibchen fehlen. Weitere Hinweise auf die
Artzugehörigkeit erhoffen wir durch die weitere Entwicklung der Tiere und das
Fortpflanzungsverhalten zu erhalten. Dann ist es vielleicht auch möglich anhand
der von uns mitgebrachten Tiere näher auf einige taxonomische Unklarheiten
einzugehen, die bereits von L. Seegers (1992) dargestellt wurden. daß es sich tatsächlich um T. sparrmanii handelt.
Diese werden mit einer Größe von bis zu 23 cm angegeben. Dafür spricht die
Ausbildung eines kräftig roten Bandes, das sich über die gesamte Länge der
Dorsale zieht und das in dieser Form nur von T. sparrmanii ausgeprägt wird.
Gegenwärtig sind die Tiere auf circa 4 cm herangewachsen und mit ihrem fast
schwarzen Schachbrettmuster auf dem Körper und der hellen Punktzeichnung in der
Dorsalen sehr attraktiv. Es bleibt abzuwarten, ob beide Geschlechter vorhanden
sind. Bei lediglich zwei Exemplaren ist die Wahrscheinlichkeit wohl eher gering.
daß es sich tatsächlich um T. sparrmanii handelt.
Diese werden mit einer Größe von bis zu 23 cm angegeben. Dafür spricht die
Ausbildung eines kräftig roten Bandes, das sich über die gesamte Länge der
Dorsale zieht und das in dieser Form nur von T. sparrmanii ausgeprägt wird.
Gegenwärtig sind die Tiere auf circa 4 cm herangewachsen und mit ihrem fast
schwarzen Schachbrettmuster auf dem Körper und der hellen Punktzeichnung in der
Dorsalen sehr attraktiv. Es bleibt abzuwarten, ob beide Geschlechter vorhanden
sind. Bei lediglich zwei Exemplaren ist die Wahrscheinlichkeit wohl eher gering.